
Der Schlüsselbeinbruch zählt zu den häufigsten Brüchen. Häufig ereignet dieser sich als Folge eines Unfalls bei Radsportarten. So auch in meinem Fall.
— Dr. Tobias Weigl
Von Medizinern geprüft und nach besten wissenschaftlichen Standards verfasst
Dieser Text wurde gemäß medizinischer Fachliteratur, aktuellen Leitlinien und Studien erstellt und von einem Mediziner vor Veröffentlichung geprüft.
Quellen ansehenInhalte
Was ist ein Schlüsselbeinbruch?
Ein Schlüsselbeinbruch beschreibt nach dem Speichenbruch den zweithäufigsten Knochenbruch des Menschen. Der Mediziner spricht in diesem Zusammenhang von einer Klavikulafraktur (von lat. clavicula ‚Schlüsselchen‘ und lat. fractura ‚Bruch‘).Die Klavikulafraktur wird je nach Lokalisation in Brüche im
- Mittleren Drittel,
- Lateralen Drittel und
- Medialen Drittel unterteilt.
Etwa 70–80 Prozent aller Klavikulabrüche betreffen das mittlere Drittel (sog. ‚Klavikulaschaftfraktur‘) und ca. 15 Prozent entfallen auf das laterale Drittel. Das mediale Drittel ist mit unter 5 Prozent äußerst selten betroffen, da es gut durch umgebende Bänder und Muskeln geschützt ist.
Als Ursachen für einen Schlüsselbeinbruch gelten größtenteils Stürze auf die ausgestreckte Hand oder die Schulter, häufig beim Sport (z. B. Radfahren), sie entstehen also vorwiegend traumatisch. In diesem Zusammenhang spricht man von einer indirekten Gewalteinwirkung, die meist einen Bruch im mittleren Drittel zur Folge hat. Weniger häufig ist eine direkte Gewalteinwirkung auf die Schulter, bspw. durch einen Schlag. Infolge eines solchen Schlages kommt es in den meisten Fällen zu einer lateralen Klavikulafraktur. In seltenen Fällen (etwa 1 von 200) verursachen Geburtstraumen bei Neugeborenen einen Bruch des Schlüsselbeins. Dies ist die Folge einer Kompression, die aus einem zu engen Geburtskanal resultiert. Ebenso kann es in seltenen Fällen dazu kommen, dass sich Schlüsselbeinbrüche durch örtliche oder abgesiedelte Tumoren ergeben, deren Wachstum das Schlüsselbein zerstört und einen Bruch provoziert. Dann spricht man von einem krankhaften Bruch (sog. ‚pathologische Fraktur‘).
Wenn Sie vermuten, dass bei Ihnen ein Schlüsselbeinbruch vorliegt, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen.
Die Symptome: Welche Beschwerden treten im Zusammenhang mit einer Klavikulafraktur auf?
Unmittelbar nach dem Unfall stellen sich Schmerzen in der Schulter ein, vor allem bei Bewegung und bei Druck. Überdies ist meist unmittelbar auch die Beweglichkeit eingeschränkt und kurze Zeit darauf eine Schwellung über der Stelle, an der sich der Bruch ergeben hat, sichtbar. Als weiteres allgemeines Symptom einer Fraktur gesellt sich noch die sogenannte Krepitation hinzu. Dabei handelt es sich um ein fühl- und hörbares Knirschen, das entsteht, wenn Knochenbruchenden aneinander reiben. Es kann auch sein, dass das Schlüsselbein verkürzt erscheint. Hinzu kommt möglicherweise ein Taubheitsgefühl, das auf verletze Nerven hinweist. Beizeiten kann auch eine Art Stufe ertastet werden – dies kann bspw. dann passieren, wenn die infolge eines Bruchs entstehenden Fragmente in Teilen durch das Gewicht des Arms nach unten gezogen werden. Äußerst selten ergeben sich offene Klavikulafrakturen, bei denen Knochen die Haut durchspießen.
Eine Klavikulafraktur kann bei Neugeborenen zunächst leicht übersehen werden, da als Symptom eine Schonhaltung zu beobachten ist, die auch auf eine Lähmung schließen lässt.
Wer ist am ehesten betroffen?
Die Klavikulafraktur gilt neben dem handgelenksnahen Speichenbruch (sog. ‚distale Radiusfraktur‘) und der Schenkelhalsfraktur als einer der häufigsten Brüche des Menschen. Bei etwa 10 Prozent aller Brüche handelt es sich um einen Bruch des Schlüsselbeins, wovon wiederum 70–80 Prozent das mittlere Drittel betreffen. In Bezug auf die erwachsene Bevölkerung erleiden Männer etwa doppelt so häufig wie Frauen Klavikulafrakturen, während das linke Schlüsselbein häufiger betroffen ist als das rechte. Beidseitige Frakturen sind äußerst selten. Überdies ist der Schlüsselbeinbruch der häufigste geburtsbedingte Knochenbruch.
Klavikulafrakturen ergeben sich bei Neugeboren bspw. dann, wenn ihr Schulterbereich zu breit ist (sog. ‚makrosom‘). Ebendiese Makrosomie ist häufig auf einen Diabetes mellitus der Mutter zurückzuführen.
Die Entstehung eines Schlüsselbeinbruchs wird durch verschiedene Risikofaktoren begünstigt. Darunter fallen vor allem verschieden Sportarten wie:
- Radfahren und Mountainbiking
- Skifahren und Snowboarden
- Motorradfahren
In diesem Zusammenhang kommt vor allem der Umstand zum Tragen, dass der oder die Sporttreibende vornüber oder über den Lenker stürzt und auf Kopf oder Schulter aufkommt.
Was tut der Arzt? Teil 1: Die Diagnose
Am Anfang der Diagnose steht das Anamnesegespräch, in welchem der Arzt die Umstände der Beschwerden erfragt. Wie lange bestehen die Beschwerden schon? Wie äußern sich diese? Nimmt der Patient regelmäßig Medikamente? Wie ist es zu dem Sturz gekommen bzw. wie ist der Patient aufgekommen?
Darauf folgt die klinische Untersuchung, im Rahmen welcher der Arzt mittels Abtasten die Sensibilität sowie Motorik des betroffenen Armes überprüft. Überdies schaut er nach, ob eine Durchblutung gewährleistet ist, da bei einer Klavikulafraktur auch Nerven und Gefäße verletzt sein können.
Abgerundet wird die Diagnose durch eine Röntgenaufnahme. Diese kann die Diagnose Klavikulafraktur sichern und gibt zudem Aufschluss über etwaige Begleitverletzungen, bspw. der Lunge oder des Brustfells (sog. ‚Pleura‘), das sich in der Brusthöhle befindet. Außerdem dient die Röntgenaufnahme dazu, im Rahmen einer sogenannten Differenzialdiagnose andere Verletzungen mit ähnlichem Beschwerdebild auszuschließen, zum Beispiel eine Sprengung des Akromioklavikulargelenks.
Klavikulafraktur/SchlüsselbeinbruchZweithäufigste Fraktur bei Erwachsenen
In 70–80 Prozent der Fälle ist das mittlere Drittel der Klavikula betroffen
Häufige Ursache sind Radsportarten
Männer sind doppelt so häufig betroffen wie Frauen
Symptome
- Schmerzen bei Bewegung und Druck
- Eingeschränkte Beweglichkeit
- Krepitation (hör- und fühlbares Knirschen)
- Schlüsselbein scheint verkürzt
- Taubheitsgefühl (wenn Nerven betroffen sind)
- Fühlbare Stufe
- Bei offener Fraktur: Durchspießen
Was tut der Arzt? Teil 2: Die Behandlung
Die Behandlung einer Klavikulafraktur kann auf zwei Arten erfolgen: konservativ oder chirurgisch/operativ. Dabei wird je nach Verletzungsbild individuell entschieden, welche Therapie vonnöten ist.
Oft ist eine konservative Therapie bei einem Schlüsselbeinbruch das Mittel der Wahl. Gegebenenfalls muss ein Lokalanästhetikum gespritzt werden, unter dessen Wirkung dann eine Reposition der Knochenfragmente erfolgen kann. Patienten bekommen dann meist einen sogenannten Rucksackverband, den Erwachsene für bis zu vier Wochen tragen müssen. Dabei handelt es sich um ein medizinisches Hilfsmittel, mit dem die Schultern kräftig nach hinten gezogen werden, allerdings nur bis zur Toleranzgrenze, sodass es nicht zu Blutstau oder einem Taubheitsgefühl kommt. Dieser Zug gewährleistet, dass die Knochenfragmente aufeinandergestellt werden und einer Verkürzung des Schlüsselbeins vorgebeugt wird. Unterstützend werden oft Medikamente zur Behandlung der Schmerzen verabreicht.
Videos – Gängige Schmerzmedikamente – Wirkungen und Nebenwirkungen von Paracetamol, Ibuprofen und Diclofenac
Die folgenden Beiträge widmen sich typischen Medikamenten, die bei der Behandlung von Schmerzen zum Einsatz kommen. Worin ihre Wirkungen und Nebenwirkungen und dementsprechend Vor- sowie Nachteile bestehen, erklärt Ihnen Schmerztherapeut Dr. Tobias Weigl.
Lesen Sie gerne auch die zugehörigen Fachartikel zu Paracetamol, Ibuprofen und Diclofenac.
Je seitlicher (sog. ‚lateraler‘) in Richtung Schultergelenk sich eine Klavikulafraktur befindet, desto eher wird diese operiert!
Erweist sich die Fraktur als schwerwiegender und kann mit konservativen Mitteln nicht ausreichend therapiert werden, so muss eine Operation erfolgen. Wichtig auch hier: Die Operation hängt immer vom Einzelfall ab. Das Schlüsselbein muss bspw. vor allem dann operativ stabilisiert werden, wenn ein Bruch zu stark verschoben ist, sich eine kosmetisch störende Stufe ergibt, eine Durchspießung der Haut droht oder bereits stattgefunden hat sowie wenn sich andere Verletzungen, bspw. von Blutgefäßen, Nerven oder Lunge, ergeben haben. Ebendiese Stabilisation erfolgt meist durch den Einsatz von Platten oder Schrauben oder elastischen Nägeln. Selten und vor allem dann, wenn sich Brüche am äußeren Rand des Schlüsselbeins ergeben, werden Drahtschlingen verwendet.
Ob operiert wird, hängt stets stark vom Einzelfall ab. Worin bestehen bspw. Nutzen und Risiken einer Operation? Gerade bei älteren Patienten kann es infolge einer Narkose eher zu Komplikationen kommen. Und auch wenn eine Operation zum Beispiel das Risiko einer Pseudarthrose senkt, sind die Gelenke älterer Menschen oft bereits arthrotisch verändert, der Gelenkknorpel ist schon abgenutzt. So ist eine Operation bspw. gerade bei jüngeren Patienten indiziert, die auf eine uneingeschränkte Funktionalität der Schulter angewiesen sind, sei es im Sport oder im Beruf. Hinzu kommt, dass eine operative Behandlung oft genauso viel Erholungszeit in Anspruch nimmt wie eine Operation.
Häufige Patientenfragen
Wieviel Schonzeit geht mit der Behandlung eines Schlüsselbeinbruchs einher?
Dr. T. Weigl
Generell kann der Arm nach einer Operation relativ schnell wieder bewegt werden. Eine volle Belastung sollte aber erst nach einer Schonzeit von etwa 8–12 Wochen stattfinden. Übrigens gilt ebendieser zeitliche Maßstab auch für die Behandlung ohne Operation.
Kinder können den Arm früher wieder voll belasten als Erwachsene. Ist es ihnen möglich, die Arme nach etwa vier Wochen wieder schmerzfrei und uneingeschränkt zu bewegen, kann auch eine volle Belastung stattfinden.
Warum reicht eine konservative Behandlung manchmal nicht aus?
Dr. T. Weigl
Wenn die Knochen zu stark disloziert und instabil sind, ist ein ordentliches Zusammenwachsen oft nicht mehr gewährleistet. Überdies sollte vor allem dann, wenn die Gefahr einer sogenannten Pseudarthrose besteht, eine Operation erfolgen. Denn bei der Pseudarthrose verheilt ein Knochen „falsch“. Anstatt eines qualitativ höherwertigen Knochens bildet sich dann eine bindegewebige Narbe und der von dem Bruch betroffene Körperteil kann nicht mehr belastet werden.
Bei einer Pseudarthrose handelt es sich nicht um die „Volkskrankheit“ Arthrose. Diese wird ausgiebig in anderen Artikeln erörtert. Die eigentliche Arthrose beschreibt eine degenerative Erkrankung der Gelenkknorpel, infolge welcher Gelenke aufeinander reiben und verschleißen.
Wie gestaltet sich die Physiotherapie bei einem Schlüsselbeinbruch?
Dr. T. Weigl
Die Therapieziele der Physiotherapie bei Klavikulafraktur umfassen die Aspekte Schmerzlinderung, Tonusregulation, Verbesserung der Beweglichkeit, Verbesserung der Kraft sowie den Aufbau des Stützlastarms. Dahingehend kommen Methoden wie Massage, Manuelle Therapie, Narbenmassage sowie die sogenannte Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation (kurz PNF). Bei letzterer Methode handelt es sich um eine Behandlungstechnik, bei der Bewegungen durch das Benutzen von Umwelteinflüssen, optischen sowie propriozeptiven Reizen erleichtert werden. Propriozeption, vielleicht besser bekannt als Tiefensensibilität, beschreibt unsere Fähigkeit, festzustellen, in welcher Haltung sich unser Körper befindet, selbst mit geschlossenen Augen.
Verwandte Themen
- Das blaue Auge – das Veilchen – das orbitale Hämatom – Ursachen und Behandlung
- Bluterguss/Hämatom: Was tun bei blauen Flecken?
- Nasenbeinbruch – harmlos oder Notfall?
- Schürfwunden
- Ischiasschmerzen – Ursachen, Symptome & Therapie der Ischialgie
- Die wichtigsten rezeptfreien Schmerzmittel – Nebenwirkungen & die richtige Einnahme
- Häufige Verletzungen bei Fahrradunfällen
- Schulterschmerzen & Schulterverletzungen durch Impingement, Kalkschulter und andere Ursachen
- Schultergelenksverletzungen
- Knochenzyste – Gefahr eines plötzlichen Knochenbruchs?
- Fingerbruch – so gefährlich ist ein gebrochener Finger!
Haben auch Sie Erfahrungen mit Schlüsselbeinbrüchen? Möchten Sie sich bei uns über Fahrradunfälle erkundigen? Nutzen Sie unsere Kommentarfunktion unten, um von Ihren Erfahrungen zu berichten und sich mit anderen auszutauschen!
Die hier beschriebenen Punkte (Krankheit, Beschwerden, Diagnostik, Therapie, Komplikationen etc.) erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird genannt, was der Autor als wichtig und erwähnenswert erachtet. Ein Arztbesuch wird durch die hier genannten Informationen keinesfalls ersetzt.
Autoren: Dr. Tobias Weigl, Tobias Möller
Lektorat: Sebastian Mittelberg
Datum: 12.07.2018
Quellen
- Susanne Andreae (2009): EXPRESS Pflegewissen Chirurgie und Orthopädie. Georg Thieme Verlag, Stuttgart.
- Susanne Andreae (2008): Lexikon der Krankheiten und Untersuchungen, 2. Auflage. Georg Thieme Verlag, Stuttgart.
- Michael Bedall (2016): Schlüsselbeinbruch.
- Klaus Hofmann (2011): Der sechste Sinn.
- Christine Mayer, Werner Siems (Hrsg.) (2011): 100 Krankheitsbilder in der Physiotherapie. Springer-Verlag, Heidelberg.
- Oliver Pieske et al. (2008): Die Klavikulaschaftfraktur – Klassifikation und Therapie, in: Unfallchirurg 111, S. 387–394.
- Miguel Pishnamaz et al.: Fehlverheilte Knochenbrueche – Patienteninformation.
- Gereon Schiffer et al. (2010): Klavikulaschaftfraktur. Keine harmlose Bagatellverletzung – Aktuelle Therapiekonzepte, in: Deutsches Ärzteblatt International 107/41, S. 711-717.
- Benedikt Schliemann et al. (2014): Die laterale Klavikulafraktur – Grundlagen, OP-Indikationen, Versorgungstechniken, in: Obere Extremität 14, S. 4-6.
- Tim Schmidt (2014): Claviculaschaftfraktur – Ein Vergleich operativer und konservativer Therapieverfahren.
- Georg Thieme Verlag (Hrsg.) (2015): I care Krankheitslehre. Georg Thieme Verlag, Stuttgart.

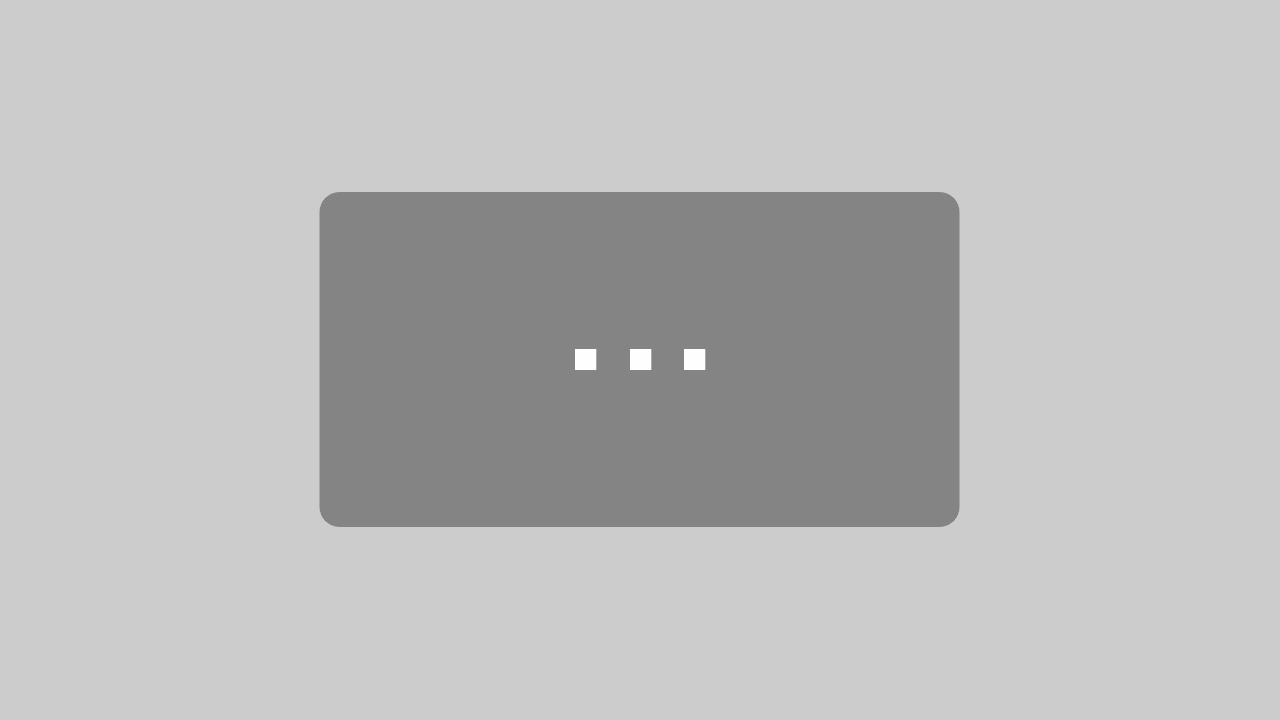
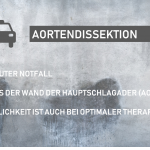
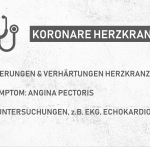






Was denkst Du?