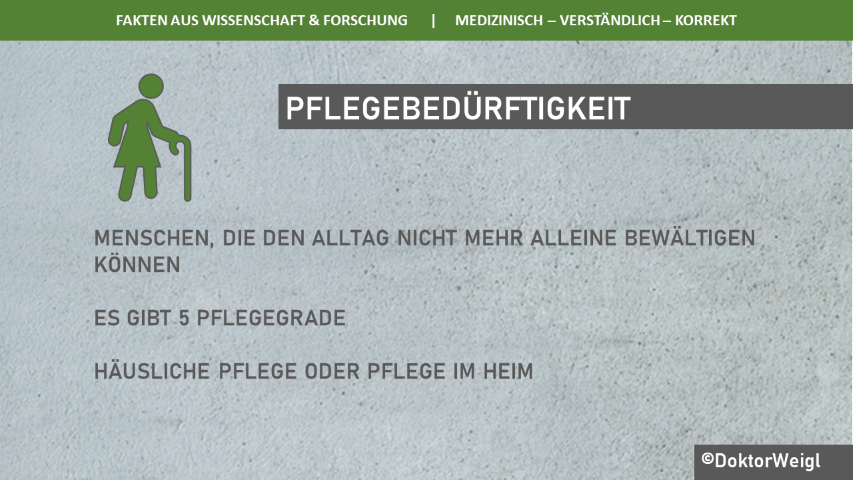
Auf einen Blick – Pflegebedürftigkeit
Was heißt Pflegebedürftigkeit?
- Personen sind pflegebedürftig, wenn sie gesundheitlich bedingt in ihrer Selbstständigkeit oder in ihren Fähigkeiten eingeschränkt sind
- in diesem Fall benötigen Pflegebedürftige Hilfe durch andere
Welche Pflegegrade gibt es?
- 5 Pflegegrade
- der Pflegegrad wird durch ein/e Gutachter*in bestimmt
Welche Pflegemöglichkeiten gibt es?
- häusliche Pflege durch Angehörige und/oder Pflegekräfte
- Teil- oder vollstationäre Pflege
- Kombinationen dieser Modelle
Es gibt viele Gründe dafür, dass eine Person pflegebedürftig wird: Alterungsprozesse, Erkrankungen, Unfälle und vieles mehr. In diesen Fällen sind Betroffene u. U. nicht mehr in der Lage, ihren Alltag vollumfänglich selbstständig zu bewältigen und benötigen Unterstützung – meist durch Angehörige oder Pflegekräfte. Doch was heißt ‚Pflegebedürftigkeit‘ eigentlich, wie werden die Pflegegrade bestimmt und welche Möglichkeiten zur Pflege gibt es überhaupt? Dies und mehr klären wir im nachfolgenden Artikel.
Was bedeutet ‚Pflegebedürftigkeit‘?
Von Pflegebedürftigkeit wird gesprochen, wenn Personen durch gesundheitlich bedingte Einschränkungen nicht mehr nicht die Selbstständigkeit oder Fähigkeiten besitzen, ohne Hilfe Ihren Alltag zu bestreiten. Dabei muss es sich rechtlich gesehen um Personen handeln, die körperliche, psychische oder kognitive Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen/Anforderungen nicht mehr völlig alleine ausgleichen oder bewältigen können. Die Pflegebedürftigkeit muss dafür festgestellt werden, zudem erfolgt die Einordnung in einen Pflegegrad. Dieser Pflegegrad entscheidet, welche Leistungen der Pflegeversicherung durch Betroffene in Anspruch genommen werden können und welche nicht. Wichtig ist zudem, dass die Pflegebedürftigkeit auf Dauer, d. h. voraussichtlich länger als 6 Monate, bestehen muss.
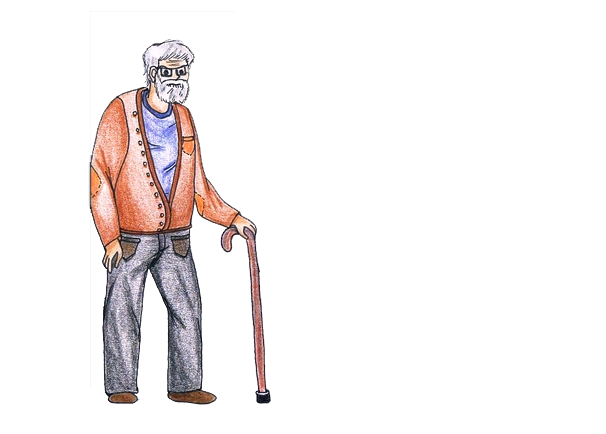
Wie wird der Pflegegrad festgestellt?
Nachdem Sie einen Antrag bei der Pflegekasse gestellt haben, lässt diese u. a. vom Medizinischen Dienst und anderen unabhängigen Gutachter*innen ein Gutachten erstellen, in dem im Detail der Pflegegrad ermittelt wird. Der/die Gutachter*in kommt hierfür an einem vereinbarten Termin zur betroffenen Person in die Wohnung bzw. in die Pflegeeinrichtung. Im Idealfall sollten dann Angehörige bzw. Betreuer*innen der betroffenen Person vor Ort sein. Der/die Gutachter*in macht sich ein Bild von der Selbstständigkeit der betroffenen Person und ergänzt dieses durch Gespräche mit den Angehörigen und anderen Beteiligten.
Damit die Pflegebedürftigkeit sachgemäß eingeschätzt werden kann, kommt ein ‚Begutachtungsinstrument‘ zum Einsatz: Dieses Instrument geht von der individuellen Pflegesituation aus und orientiert sich u. a. daran, was die/der Pflegebedürftige im Alltag selbstständig leisten kann oder welche Fähigkeiten noch vorhanden sind. Die individuellen, spezifischen Beeinträchtigungen der eigenen Selbstständigkeit stehen im Vordergrund, unabhängig von der Art der Einschränkung. Die/der Gutachter*in betrachten für die Einschätzungen v. a. folgende Lebensbereiche:
- Mobilität – Kann die Person sich selbstständig in der Wohnung bewegen, ist bspw. Treppensteigen möglich?
- Geistige und kommunikative Fähigkeiten: Damit ist alles gemeint, wenn es um das Verstehen, Erkennen oder Entscheiden in verschiedenen Situationen geht. Kann die pflegebedürftige Person z. B. Gespräche mit Menschen führen, mögliche Gefahrensituationen einschätzen oder sich räumlich eigenständig orientieren?
- Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Weist die pflegebedürftige Person Ängste oder Aggressionen auf? Ist sie nachts äußerst unruhig? Wehrt sie pflegerische Maßnahmen ab?
- Selbstversorgung: Kann die betroffene Person sich z. B. selbstständig waschen, anziehen, essen oder trinken?
- Selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen – sowie deren Bewältigung: Kann die antragstellende Person ihre Medikamente eigenständig einnehmen oder bspw. den Blutzucker selbst messen?
- Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte: Kann die/der Antragsteller*in ihren Tagesablauf selbstständig gestalten? Kann sie ohne Hilfe direkten Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen oder selbstständig etwa Events besuchen?
Anhand eines Punktesystem werden diese Kategorien je einzeln bewertet, sodass für jeden Lebensbereich die mögliche Beeinträchtigung sichtbar wird. Jeder Bereich fließt etwas anders gewichtet in die Bewertung ein. Am Ende werden diese Punkte addiert und ergeben in der Summe einen Wert, der für je einen der 5 Pflegegrade steht; darüber hinaus wird geprüft, ob möglicherweise mit Reha-Maßnahmen die Pflegebedürftigkeit hinausgezögert oder gar vermieden werden kann. Auch, wenn eine Pflegebedürftigkeit bestehen sollte, können solche Maßnahmen sinnvoll sein, um die Einschränkungen ggf. zu verringern oder zumindest nicht stärker werden zu lassen. Am Ende erhält die Pflegekasse das Gutachten.
Die soziale Pflegeversicherung ist eine Pflichtversicherung in Deutschland und sichert seit 1995 einen Teil des Pflegerisikos aller abhängig Beschäftigten, Rentner*innen, Arbeitslosen und ihrer Familien ab. Es besteht zudem die Möglichkeit, eine private Pflegezusatzversicherung abzuschließen, bei der dann weitere Leistungen inbegriffen sind.
Welche Pflegegrade gibt es?
Je nachdem, welcher Wert bei dem Punktesystem herauskommt, wird die betroffene Personen einem von 5 Pflegegraden zugeordnet:
- 12,5 bis unter 27 – Pflegegrad 1
- ab 27 bis unter 47,5 – Pflegegrad 2
- ab 47,5 bis unter 70 – Pflegegrad 3
- ab 70 bis unter 90 – Pflegegrad 4
- ab 90 bis 100 – Pflegegrad 5
Was bedeuten diese Pflegegrade aber eigentlich? Sie ordnen ein, wie stark die Beeinträchtigungen der betroffenen Person sind und welche Leistungen erforderlich für die Pflege dieser Person sind:
- Pflegegrad 1: Geringe Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
- Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
- Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten
- Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
- Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung
Welche Möglichkeiten der Pflegebedürftigkeit gibt es?
Was passiert, wenn die Pflegebedürftigkeit festgestellt wurde? Je nachdem, in welchen Pflegegrad die pflegebedürftige Person eingeordet wurde, gibt es unterschiedliche Modelle, wie die Pflege aussehen kann; teilweise können diese Modelle aber auch kombiniert werden. Wichtig: Die verschiedenen Angebote zur Alltagsunterstützung müssen nach dem jeweiligen Landesrecht anerkannt sein. Die Angebote und Leistungen können sich je nach Bundesland entsprechend unterscheiden. Sie sollten sich daher unbedingt von Ihrer Krankenkasse bzw. Pflegekasse beraten lassen.
Selbstbestimmt leben trotz Pflegebedürftigkeit: Möglichkeiten häuslicher Pflege
Von häusliche Pflege spricht man, wenn die pflegebedürftige Person nicht in einer teil- oder vollstationären Einrichtung lebt, sondern in den eigenen vier Wänden gepflegt wird. Die häusliche Pflege hat den Vorteil, dass sie es den Pflegebedürftigen ermöglicht, so lange wie möglich in der vertrauten heimischen und familiären Umgebung zu bleiben. Je nach Pflegegrad werden unterschiedliche Leistungen gewährt, folgende Möglichkeiten bestehen u. a. für die häusliche Pflege:
Pflegegeld
Das Pflegegeld wird von der Pflegeversicherung ausgezahlt, wenn die betroffene Person z. B. von Angehörigen oder Freund*innen gepflegt werden will und nicht von einem ambulanten Pflegedienst. Hierfür muss mind. Pflegegrad 2 vorliegen, die Leistungen sind an den Pflegegrad geknüpft:
| Pflegebedürftigkeit | Leistungen pro Monat |
|---|---|
| Pflegegrad 2 | 316 € |
| Pflegegrad 3 | 545 € |
| Pflegegrad 4 | 728 € |
| Pflegegrad 5 | 901 € |
Die pflegebedürftige Person verfügt frei über das Pflegegeld, meist gibt sie das Geld weiter an die pflegende Person. Grundsätzlich kann das Pflegegeld auch mit ambulanten Pflegesachleistungen kombiniert werden.
Pflegedienste und Pflegesachleistungen
Ein ambulanter Pflegedienst unterstützt die Pflegebedürftigen und die Angehörigen bei der häuslichen Pflege. Die Leistungen, die ein Pflegedienst erbringen soll, werden im Vorfeld abgesprochen und bezieht sich z. B. auf Hilfe bei der Haushaltsführungen, bei der Körperpflege, bei der Ernährung des/der Pflegebedürftigen und berät die Angehörigen. Die Pflegeversicherungen übernimmt für betroffene Personen, die mind. Pflegegrad 2 vorweisen, bis zu einem bestimmten Höchstsatz die Kosten für einen ambulanten Pflegedienst. Vor der Inanspruchnahme der Leistungen erstellt der Pflegedienst einen Kostenvoranschlag über die voraussichtlichen Kosten der gewünschten Dienste.
| Pflegebedürftigkeit | max. Leistungen pro Monat |
|---|---|
| Pflegegrad 2 | 724 € |
| Pflegegrad 3 | 1.363 € |
| Pflegegrad 4 | 1.693 € |
| Pflegegrad 5 | 2.093 € |
Ambulante Betreuungsdienste
Ambulante Betreuungsdienste sollen Betroffene unterstützen und pflegende Angehörige entlasten. „Zielgruppe“ dieser Betreuungsdienste sind v. a. Personen, die kognitive Einschränkungen vorweisen, also z. B. in ihrer Sprachfähigkeit eingeschränkt sind oder Probleme bei der Erinnerung, der Aufmerksamkeit oder der Wahrnehmung zeigen. Ein ambulanter Betreuungsdienst übernimmt im Unterschied zu ambulanten Pflegediensten keine Aspekte der Grundpflege wie Körperpflege, sondern unterstützt die Pflegebedürftigen im Haushalt und betreut sie z. B. bei behördlichen und organisatorischen Angelegenheiten. Spaziergänge, Spiele oder Übungen zur Gedächtnisförderungen können auch Teil dieser Betreuung sein. Ab Pflegegrad 2 können ambulante Betreuungsdienste als Pflegesachleistung mit der Pflegekasse abgerechnet werden. Ambulante Pflegedienste werden in Deutschland bisher noch nicht sonderlich oft genutzt.
Förderungen für ein barrierefreies Zuhause
Es besteht die Möglichkeit, dass Pflegebedürftige Zuschüsse für Wohnraumanpassungen erhalten, um die Selbstständigkeit so weit wie möglich zu erhalten. Klassische Beispiele hierfür sind zu hohe Duscheinstiege oder Treppen vor der Haustür, die kein Geländer haben. Bereits ab Pflegegrad 1 kann ein Antrag auf sog. ‚wohnumfeldverbessernde‘ Maßnahmen gestellt werden, um solche Alltagshürden an die individuellen Einschränkungen anzupassen. Pro Vorhaben übernimmt die Pflegeversicherung bis zu 4.000 €, der Antrag muss aber vor den Umbaumaßnahmen gestellt werden. Das gilt auch für einen u. U. nötigen Umzug, um barrierefreies Wohnen zu ermöglichen.
Pflegekraft/Einzelpflegekraft
Einzelpflegekräfte sind u. a. selbstständige Pflegekräfte, wie z. B. Altenpfleger*innen. Für die Pflegegrade 2–5 besteht die Möglichkeit, eine solche Pflegekraft in Anspruch zu nehmen. Je nach individueller Situation kann dies sinnvoll sein, wenn den spezifischen Wünschen von Pflegebedürftigen so am besten nachgekommen werden kann, wenn etwa eine 24-Stunden-Pflege in den eigenen vier Wänden gewünscht ist.
In letzter Zeit sind hier v. a. polnische Pflegekräfte immer beliebter: Von den 2019 rund 300.000 Pflegekräften aus Osteuropa stammten die meisten aus unserem Nachbarland Polen. Polnische Pflegekräfte sind ähnlich gut qualifiziert wie deutsche Pflegekräfte und sind häufig bereit, im privaten Haushalt des Pflegebedürftigen zu wohnen, sodass eine 24-Stunden-Pflege oft problemlos realisiert werden kann. Zu den Aufgaben solcher Pflegekräfte gehören u. a. hauswirtschaftliche Tätigkeiten, die Grundpflege (z. B. Hilfe bei der Hygiene) sowie die generelle Beschäftigung mit dem/der Pflegebedürftigen (Spaziergänge, Ausflüge, u.v.m.). Die Kosten einer polnischen Pflegekraft hängen u. a. von der Art des Beschäftigungsverhältnisses ab und von der vorliegenden Qualifikation.
Teil- oder vollstationäre Pflege – Umzug ins Pflegeheim
Es gibt drei unterschiedliche Heimtypen:
- Altenwohnheim: Hier leben die Pflegebedürftigen vergleichsweise selbstständig in kleinen Wohnungen mit eigener Küche, wobei die Mahlzeiten mit anderen Bewohner*innen eingenommen werden können.
- Altenheime: Betroffene Personen, die ihren Haushalt nicht mehr alleine führen können, erhalten hier pflegerische und hauswirtschaftliche Betreuung. Auch hier leben die Pflegebedürftigen in kleinen Wohnungen oder Apartments.
- Pflegeheime: In diesem Modell werden die Pflegebedürftigen umfassend betreut, leben in der Regel aber in Einzel- oder Doppelzimmern, in denen häufig eigene Möbel mitgenommen werden können.
Heutzutage werden in den meisten Einrichtungen Kombinationen dieser Modelle verwendet.
Bei einer vollstationären Pflege übernimmt die Pflegekasse bis zu einem bestimmten Höchstsatz die Kosten für den Aufenthalt in entsprechenden Einrichtungen. Bei Pflegegrad 1 erhalten Betroffene einen Entlastungbetrag von 125 €. Für alle Pflegegrade gilt aber: Reichen die Leistungen der Pflegeversicherung nicht aus, müssen die pflegebedürftigen Personen einen Eigenanteil zahlen. Zwischen den Pflegegraden wird hierbei nicht unterschieden, der pflegebedingte Eigenanteil unterscheidet sich lediglich von Einrichtung zu Einrichtung.
| Pflegebedürftigkeit | max. Leistungen pro Monat |
|---|---|
| Pflegegrad 2 | 700 € |
| Pflegegrad 3 | 1.262 € |
| Pflegegrad 4 | 1.775 € |
| Pflegegrad 5 | 2.005 € |
Neben einer vollstationären Versorgung gibt es auch die Möglichkeit einer teilstationären Versorgung in Form einer Tages- oder Nachtpflege, bei der die Pflegebedürftigen nur für einen bestimmten Zeitraum in einer Einrichtigung verbringen. Daneben gibt es auch die Kurzzeitpflege, die v. a. in krisenhaften Situationen bei der häuslichen Pflege oder im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt zum Einsatz kommt.
Für die häusliche Pflege und ihrer Umsetzung gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Lassen Sie sich beraten, welche Modelle für Sie am besten sind!
— Dr. Dr. Tobias Weigl
Häufige Patientenfragen
Was ist eine Verhinderungspflege?
Dr. Dr. T. Weigl
Von einer Verhinderungspflege spricht man, wenn die eigentlich pflegende Person vorrübergehend nicht der Pflegetätigkeit nachkommen kann. Sie wird dann durch eine oder mehrere Personen vertreten; das können z. B. ehrenamtliche Helfer, Verwandte oder auch ein Pflegedienst sein. Die Pflegekasse übernimmt aber nur unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten und dann max. für 6 Wochen pro Jahr.
Was bedeutet eigentlich „Pflegenotstand“?
Dr. Dr. T. Weigl
Damit ist gemeint, dass die Pflegesituation in Deutschland in absehbarer Zeit schlechter wird. Derzeit fehlen mehr als 80.000 Pflegekräfte in den deutschen Krankenhäusern und durch eine immer älter werdende Bevölkerung verschärft sich dieser Zustand in Zukunft noch weiter. Die Regierung versucht mithilfe von Initiativen, den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Für die Zukunft werden aber noch viele weitere Maßnahmen nötig sein, um eine medizinische Versorgung auf diesem Niveau weiterhin zu ermöglichen.
Wo kann ich mich zum Thema „Pflege“ noch weiter informieren?
Dr. Dr. T. Weigl
Die erste Anlaufstelle ist auf jeden Fall Ihre Krankenkasse. Dort befindet sich auch die Pflegekasse, dort erhalten Sie grundlegende Informationen und Beratungen. Zusätzlich gibt es auch sogenannte „Pflegestützpunkte“, die Ihnen zusätzlich bei der Organisation helfen und Pflegeberatung anbieten. Diese Beratung kann sogar bei Ihnen zu Hause stattfinden. Dort wird dann ein individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasster Pflegeplan erstellt.
Verwandte Themen
- Pflegefortbildung – weiterbilden für die Pflege von morgen
- Gesundheitliche Probleme sollte man ernst nehmen
- Was steckt hinter der Krankheit Inkontinenz?
- Risikogruppen des Coronavirus – muss ich besonders aufpassen?
- Koordinative Fähigkeiten – Verbesserung und Erhalt durch Sport?
Haben Sie einen Angehörigen, der gepflegt werden muss? Oder sind Sie sogar selbst davon betroffen? Wie gehen Sie damit um? Nutzen Sie unsere Kommentarfunktion unten, um von Ihren Erfahrungen zu berichten und sich untereinander auszutauschen!
Die hier beschriebenen Punkte (Krankheit, Beschwerden, Diagnostik, Therapie, Komplikationen etc.) erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird genannt, was der Autor als wichtig und erwähnenswert erachtet. Ein Arztbesuch wird durch die hier genannten Informationen keinesfalls ersetzt.Autor: Dr. Dr. Tobias Weigl
Veröffentlicht am: 20.10.2022
Quellen
- Bundesgesundheitsministerium (Hg.) (2022): Pflege im Heim, in: bundesgesundheitsministerium.de.
- Bundesgesundheitsministerium (Hg.) (2022): Pflege zu Hause: Finanzielle Unterstützung und Leistungen für die ambulante Pflege, in: bundesgesundheitsministerium.de.
- Bundesgesundheitsministerium (Hg.) (2022): Pflegebedürftigkeit, in: bundesgesundheitsministerium.de.
- Bundesgesundheitsministerium (Hg.) (2022): Pflegegeld, in: bundesgesundheitsministerium.de.
- Bundesgesundheitsministerium (Hg.) (2022): Pflegegrade, in: bundesgesundheitsministerium.de.
- gesund.bund (Hg.) (2020): Häusliche Pflege: Diese Möglichkeiten gibt es, in: gesund.bund.de.
- Teri A. Reynolds et al. (2020): Emergency, critical and operative care services for effective primary care, in: Bull oft he World Health Organization 98/11, S. 728–728A.
- Verbraucherzentrale (Hg.) (2022): Ambulante Betreuungsdienste: Entlastung für die Pflege zuhause, in: verbraucherzentrale.de.
- Verbraucherzentrale (Hg.) (2022): Diese Leistungen können Sie für die Pflege beantragen, in: verbraucherzentrale.de.
- Verbraucherzentrale (Hg.) (2022): Verhinderungspflege: zeitlich begrenzte Auszeit von der Pflege, in: verbraucherzentrale.de.
- Verbraucherzentrale (Hg.) (2022): Was Pflegegrade bedeuten und wie die Einstufung funktioniert, in: verbraucherzentrale.de.
- Verbraucherzentrale (Hg.) (2022): Wohnungsanpassung: Veränderungen für ein angenehmeres Leben, in: verbraucherzentrale.de.

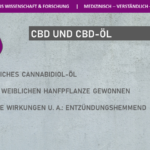
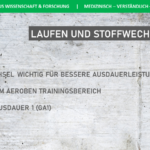









Was denkst Du?